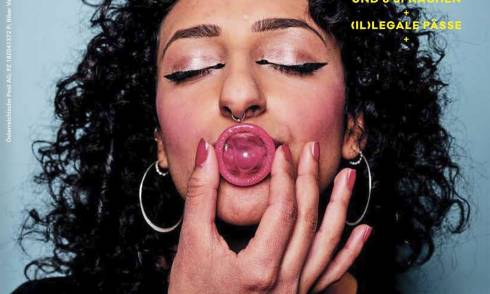Studieren statt Hyperventilieren
jara_biber_composit_v.6.jpg

Mein Uni-Alltag in den Niederlanden macht mich psychisch fertig. Anstelle von Präsenz-Unterricht und Small Talk mit Mitstudierenden wünsche ich mir: Abstand. Und Masken. Und dass ich endlich aufhöre, Atemübungen in den Klopausen zu machen.
Meine neue Universität in den Niederlanden hat endlich ihre Tore geöffnet. Mit einem strahlenden Lächeln, meinem Laptop unterm Arm und in Slow-Motion schreite ich in den Vorlesungssaal. Ich setzte mich seelenruhig neben Mitstudierende und mache mir absolut keine Gedanken darüber, dass zwischen uns sicher kein Babyelefant passt. Total entspannt unterhalte ich mich mit den fremden Menschen, die mich umgeben. Ich mache Witze, alle lachen. Wir sind jetzt Freunde.
Atemübungen am Klo
Ich weiß nicht, ob ich mir meinen ersten Tag an der Uni wirklich so vorgestellt habe. Ich weiß nur, dass mein erster Tag auf keinen Fall so ausgesehen hat. Der Zweite auch nicht, der Dritte auch nicht. Nein, nicht mal mein 26. Tag hat so ausgesehen. Seit Anfang September verbringe ich Stunden in überfüllten Räumen ohne Lüftungssystem. Ich sitze neben Menschen, die in ihre Handflächen husten und seit knapp zwei Wochen bin ich am Campus sogar Teil einer maskenlosen Masse. Wenn ich behaupten würde, dass mich all das nicht maßlos überfordert, würde ich lügen.
Tatsächlich überfordert mich mein Uni-Alltag so sehr, dass ich meine Pausen regelmäßig dazu nutze, Atemübungen in den Toiletten-Räumen zu machen. Dabei sollte ich in meinen freien Minuten doch total entspannt meine Mitstudierenden kennenlernen. Socializing eben. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das macht. Ich weiß nicht mehr, worüber man redet. Nein, ich weiß nicht mal mehr mit Sicherheit, wie ich mich vorstellen soll. Ich war nie ein unglaublich geselliger Mensch, aber seit den Corona-Lockdowns erkenne ich mich selbst fast nicht wieder.
I’m an Austrian in the Netherlands
Die Corona-Pandemie hat die sozialen Fähigkeiten vieler Menschen eingeschränkt. Über einen unnatürlich langen Zeitraum haben wir uns als Gesellschaft anti-sozial verhalten - zumindest, was den physischen Kontakt angeht. Die klinische Psychologin Jenny Taitz beobachtete bereits während der Corona-Pandemie, wie soziale Interaktionen bei ihren Klient*innen vermehrt zu Stress führten. Auch Menschen, die sich selbst als extrovertiert beschreiben würden, erlebten soziale Angstzustände, schreibt Taitz in der New York Times.
Wenn soziale Interaktionen während der Pandemie sogar extrovertierte Menschen stressen, ist es kein Wunder, dass die Post-Lockdown-Niederlande Angstzustände bei mir auslösen. In den Uni-Gebäuden in Österreich dürfen die Masken wenigstens nur am Sitzplatz abgenommen werden. Dort müssen Studierende einen 3-G-Nachweis vorweisen, um die Gebäude zu betreten. An meiner Uni in den Niederlanden hingegen ist die Lage entspannter. Das Einzige, das hier noch an Corona erinnert, sind Bodenmarkierungen. Pfeile, die mir sagen, in welche Richtung ich mich verirren soll.
Mit meinem Wunsch nach Mundschutz und Abstand fühle ich mich allein. Die meisten meiner Mitstudierenden scheinen absolut kein Problem mit der fehlenden Distanz in den Vorlesungssälen zu haben. Und mit fehlender Distanz meine ich absolut keine Distanz. Zur Veranschaulichung: Wenn mir im Vorlesungssaal ein Stift auf den Boden fällt, kann ich ihn nicht aufheben, ohne meinen Kopf auf den Oberschenkel der Person neben mir zu legen. Kein Scherz.
Alles ganz neu-normal
Die neugewonnene Nähe zu meinen Mitstudierenden ist mir zu nahe, und der Small Talk mit ihnen fällt mir unendlich schwer. So viel steht fest. Die Frage danach, warum ich mich so fühle, könnte ein Blick in mein Gehirn beantworten. Genauer gesagt in mein „soziales Gehirn“. Bei Einsamkeit und mangelndem sozialen Austausch reagiert dieses nämlich sensibel: Der Neurowissenschaftler Alexander Stahn hat beobachtet, dass sich bestimmte Hirnareale von Polarforscher*innen nach einem langen Antarktisaufenthalt verkleinern. Die Isolation, die wir während der Corona-Pandemie erlebt haben, könnte ähnlich wirken.
Erfreulicherweise ist unser Gehirn ein Muskel, der trainiert werden kann, erklärt Stahn im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Je nachdem wie Menschen auf die soziale Isolation reagieren und wie sie mit der Situation umgehen, lassen sich die Veränderungen im Gehirn rückgängig machen.
Der Weg zurück in die soziale Zukunft
Ich muss meinem Gehirn also beibringen, wieder sozial zu sein. Das kann ich tun, indem ich es trainiere, sprich indem ich mit meinen Mitmenschen interagiere, auch wenn sich das (noch) unangenehm anfühlt. Immerhin bin ich nicht die Einzige, die sich in sozialen Situationen unwohl fühlt. Laut dem US National Social Anxiety Center sind momentan alle bis zu einem gewissen Ausmaß „socially awkward“.
Es wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis meine Atemübungen überflüssig werden und ich Unterhaltungen mit Fremden nicht mehr stressig finde. Bis dahin tut es gut zu wissen, dass alles ganz normal - oder zumindest ganz neu-normal ist.
Blogkategorie: