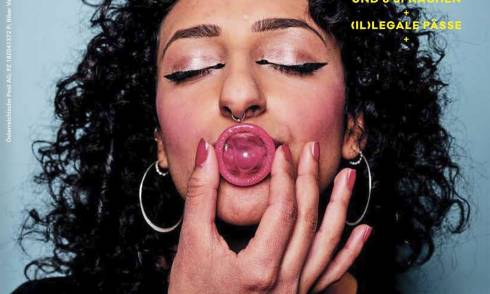Baba, ich brauche Therapie.
In vielen migrantischen Familien herrscht ein Stigma um psychische Erkrankungen und Therapie. Als ich vor drei Jahren meiner iranischen Familie erzähle, dass ich in Therapie gehe, ändert sich plötzlich unsere Familiendynamik.
Ich sitze in einem mit bunten Kissen dekorierten Praxiszimmer und warte kurz. Es begrüßt mich eine junge Frau. Sie fragt mich, wie es mir geht. Der Stuhl ist nicht sonderlich bequem. Ihre Frage auch nicht. Fortan setze ich mich ihr montagmittags gegenüber. Es geht viel um meine Familie. Viel um Identität. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Fragen, die viele in der Diaspora beschäftigen würden. Es sei in Ordnung, sich deplatziert zu fühlen. Irgendwann würde man den Platz finden. Sie selbst habe das als Kind polnischer Eltern so gefühlt. „Sie haben hier noch nie geweint“, mahnt sie irgendwann. „Während Sie hier sitzen und mir von schmerzhaften Erfahrungen erzählen, bei denen ich weinen will, haben Sie nach fast einem Jahr noch nicht geweint.“ Triumphierend lächle ich und merke im selben Moment, wie mir das Lächeln aus dem Gesicht schwindet.
Gesicht wahren. So hatte ich es gelernt. Aber diese Strategie funktionierte nicht weiter für mich. „Manche Dinge macht man mit sich selbst aus“, sagt meine Mutter gerne. „Für uns war niemand zum Reden da und wir haben es auch überlebt.“ Und da ist es wieder, das schlechte Gewissen. In der Regel spricht meine Familie nicht über Fragen der psychischen Gesundheit. Es ist kein Mangel an Fürsorge oder Mitgefühl, sondern eine schützende Logik, Gefühle als Dinge zu betrachten, die unterdrückt werden – denn niemand kann deine Gefühle verletzen, wenn du keine hast! Ich verstehe, woher es kommt. Ihre Erziehungstaktiken sind beeinflusst von ihrer eigenen strikten Erziehung und dem heftigen Überlebenscharakter, der durch die Islamische Revolution im Iran und die Flucht nach Deutschland entstanden ist.
Unser kollektiver Schmerz wird wieder einmal zum Vergleichsprodukt
Die Kinder von Zugewanderten überschreiten vielleicht niemals einen physischen Grenzübergang, aber die kulturellen Barrieren sind ebenso allgegenwärtig. Sie sind gar schwerer zu quantifizieren. Die deutsche Staatsbürgerschaft machte mich nicht immun gegen einwanderungsbedingte Stressfaktoren. Ich lerne immer noch, flexibel zu sein und der Kultur, aus der meine Eltern stammen, und der Kultur, in der ich tagtäglich lebe, standzuhalten. Wir kämpfen mit transgenerationalem Trauma – dem Einfluss oder der Übertragung von Schmerz auf folgende Generationen. Nicht nur Verhaltensweisen oder der Erziehungsstil können davon beeinflusst werden, sondern auch die Gene. Die Existenzangst brennt sich quasi in unsere DNA.
Ich muss meinem Vater erzählen, dass ich in Therapie gehe. Während ich mich mit meiner großen Reisetasche zu ihm aufmache, denke ich an die 100 verschiedenen Antworten, die er mir geben wird. Viele dieser Antworten gibt er mir tatsächlich. Mit mir sei doch alles okay. Ich müsse mir keine Hilfe suchen. Was er und seine Kollegen im Grenzgebiet Irans erlebt hätten, das wäre wahrhaft schrecklich gewesen. Unser kollektiver Schmerz wird wieder einmal zum Vergleichsprodukt. „Baba, ich brauche Therapie“, platzt es aus mir heraus. Schweigen und sich durchboxen – das ist tief in unserer Familie verankert. Friss oder stirb. Sie sind geflohen, damit es mir besser geht. Damit ich gefördert werde, damit ich erfolgreich werde.
Indem ich in Therapie gehe, geht meine Familie in Therapie
Einerseits möchte ich unendliche Dankbarkeit für die Risikobereitschaft meiner im Exil lebenden Eltern zeigen, andererseits gehe ich unter diesem auferlegten Druck ein. Der Druck meiner Eltern, der Druck der Gesellschaft, der Druck, als migrantisches Kind doppelt zu leisten, der Druck, angepasst zu sein. Es fühlt sich an wie ein unerträglich schwerer Klotz, der sich an mir abschleift, so wie meine knirschenden Zähne bei Nacht. In diesem Erwartungskarrussell wird mir schlecht vor Schwindel. Unsere Unterhaltung wandelt sich allerdings in einen unerwarteten Einblick in die Biografie meines Vaters. Er schaut mich lange an: „Ich war zwei Monate in der stationären Therapie. Ich konnte nicht mehr raus aus meinem Bett. Aus Angst konnte ich nicht mal in die Straßenbahn steigen.“
Das ist das erste Mal, dass mir mein Vater das erzählt. Nicht nur das. Er fängt nach und nach an, mir noch mehr aus seiner Vergangenheit zu berichten. Es wirkt so, als wäre ich die erste Person, mit der er je darüber spricht. Offensichtlich habe ich sie geöffnet, die Büchse der Pandora. Mit viel Leid und einer Spur Hoffnung. Die war vorher nicht da. Indem ich in Therapie gehe, geht meine Familie in Therapie. Das ist eine neue Verantwortung, der ich mir bis dato nicht bewusst war. Aber ich nehme die Aufgabe erhobenen Hauptes an. Ich reiße Wunden auf, die vor meiner Zeit entstanden sind und flicke sie mühselig wieder zusammen. Bis irgendwann meine Familie frei miteinander kommunizieren kann und wir das Stigma um psychische Erkrankung und die Scham um den Bedarf nach Hilfe ablegen. Damit wir heilen. Wunde für Wunde.
Blogkategorie: