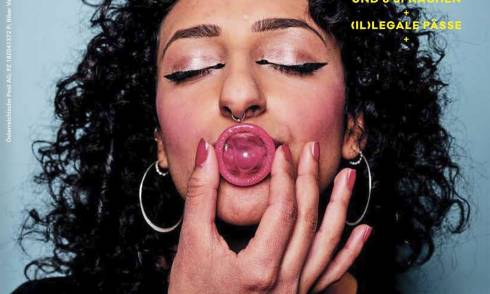Der Grenzzaun meiner Kindheit
Wie es sich manchmal im Leben so begibt, bin ich zurückgekehrt an den Ort meiner Kindheit, zumindest in seine Nähe. Der Schauplatz der ersten 10 Jahre meines Lebens, kaum größer als zwei oder drei Häuserblocks, und doch groß genug für eine ganze Welt. Mag sein, aus purer Nostalgie, oder aber auch aus bedrückender Faszination, nehme ich mir manchmal auch die Zeit für einen Spaziergang durch diese paar Straßen. Es scheint mir dann ein jedes Mal, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Und eigentlich, da bin ich sicher, spaziere ich nicht durch einen richtigen Stadtteil, sondern vielmehr durch die Kulissen einer Filmstadt, in der kein echtes Leben mehr stattfindet, jetzt, wo meine Kindheitsepisoden im Kasten sind. Der Drehort meiner Kindheit. Ich blicke auf den Hauseingang und kann mir nicht vorstellen, dass sich hinter ihm noch das Stiegenhaus verbirgt, in welchem meine Brüder und ich am liebsten über das Geländer nach unten gerutscht sind, und beim Hinauflaufen immer gleich zwei Stufen auf einmal genommen haben. Undenkbar, dass Menschen hier leben, echte Menschen mit echten Leben. Ich stehe auf dem Platz vor dem Haus und sehe, wie sich kaum etwas verändert hat. Alles sieht genauso aus wie früher, nur etwas kleiner, als ich es aus dem Film in Erinnerung habe. Und als ich da so stehe und mich umsehe, merke ich, wie mir die Tränen kommen. Es sind wütende Tränen, wie ein Kind sie weint, das die Welt um sich herum nicht mehr versteht.
Ich erinnere mich, wie ich eines Sonntags in den frühen Neunzigern bei meiner Mutter in der Küche saß und ihr beim Kochen zusah. Nebenbei lief der Radio, dessen vertrautes Säuseln sich zusammen mit dem Essensduft und der Nähe zu meiner Mutter zu einem Gefühl von Geborgenheit vereinte. Zwischen mehreren Musik- und Redebeiträgen setzte im Radio plötzlich der Jingle einer Kampagne namens „Nachbar in Not“ ein. Noch heute kann ich mich genau an die Melodie erinnern. Und an das Gefühl, das mit dieser Melodie verbunden war. Stolz waren wir alle. Stolz darauf, dass es in unserem Österreich eine Kampagne wie diese gab. Wir Österreicher – da waren wir uns schließlich alle einig – sind nämlich ein Volk, das anderen in Not hilft. Und Krieg, das wusste ich schon damals, ist, neben Armut, ein unvorstellbar großes Elend. Nach dem Jingle folgte die die Geschichte eines kleinen Jungen aus Bosnien. An die Geschichte kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich mich mit dem Jungen verbunden fühlte, von Kind zu Kind.
Verbunden fühlte ich mich auch mit dem einzigen türkischen Mädchen in unserer Klasse. Damals fand ich es vor allem spannend, dass das Mädchen eine fremde Sprache sprechen konnte. Weit und breit gab es niemanden, der mit Parolen wie „Daham statt Islam“ um sich geworfen hätte oder auch nur den geringsten Einwand gegen unsere Freundschaft gehabt hätte. Denn, und da waren wir uns alle einig, eine Freundschaft ist immer eine tolle Sache.
Vielleicht haben sich deshalb bei uns auch alle so gefreut, als Österreich der EU beigetreten ist. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Eine Freundschaft zwischen Staaten wäre sicher die beste Grundlage, um den Frieden langfristig zu sichern. Und das Beste daran war, da waren wir uns alle einig, dass damit die Grenzen zwischen den Staaten nach und nach verschwinden würden.
In der Mittelschule hatte ich den denkbar schlechtesten Geschichtsunterricht. Der Zweite Weltkrieg war für mich nicht mehr als ein vollgeschriebenes DIN-A4 Blatt mit Jahreszahlen und trockenen Fakten. Aber eine Lektion wurde uns dennoch vermittelt, nämlich, dass wir uns alle einig sind, dass wir so etwas nie wieder geschehen lassen wollen. Und dass wir stolz darauf sind, dass es in unserem Österreich Gesetze gibt, die uns das sogar verbieten.
Nie werde ich die Leere in den Augen meiner Oma vergessen, als sie auf mein Nachfragen sagte: „Glaubst du wirklich, wir haben das alles gewusst? Wenn wir das gewusst hätten, dann….“. Der Satz war nicht zur Vollendung bestimmt. Eines wurde mir aber auch so klar, nämlich dass wir, also alle ab der Generation meiner Eltern, uns sicher darüber einig sind, dass wir niemals zulassen würden, dass es uns auch so ergeht. Wir würden genau hinschauen. Wir würden, aufgeklärt wie wir sind, bereits die ersten Anzeichen erkennen und uns dagegen auflehnen.
Mein Opa war, so denke ich heute, ein Nazi. Mein Vater würde diese Aussage jetzt sicher aufs heftigste dementieren und relativieren, aber ich glaube schlicht nicht, dass man nur ein bisschen Nazi sein kann. Nazi ist ja nicht wie eine Moderichtung. Du kannst nicht heute ein bisschen Nazi und morgen ein bisschen street style sein. In meiner Kindheit spielte das keine Rolle. Je älter ich wurde, umso mehr verstand ich jedoch, dass genau hier der Kern meiner Identität als Österreicherin liegt: In der Möglichkeit, einen Unterschied zur Vergangenheit zu machen.
Tatsächlich gibt es nichts, worauf ich als Österreicherin so stolz bin, wie auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Wir sind kein Volk, das zu jeder Gelegenheit die Nationalflagge schwingt und laut grölend kundtut, wie stolz wir auf unsere nationale Identität sind. Aber meine Identität wurzelt in der Entscheidung, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sie nicht wieder aufkommen zu lassen, nicht einmal in Ansätzen. So dachte ich. Und egal, wie weit unsere politischen Ansichten auch auseinanderklaffen mögen, gibt es immer eine unsichtbare Grenze, an der die Diskussion in wortlosem Einvernehmen verstummt. Diese Grenze heißt Menschlichkeit, so dachte ich.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, geht mir durch den Kopf, während ein österreichischer Politiker davon spricht, dass man Asylwerber in Militärflugzeugen abschieben sollte, „da können sie dann schreien und sich an-urinieren“. Während Menschen seelenruhig nationalistische Hassparolen posten, Flüchtlingen den Tod nicht nur wünschen, sondern laut eigenen Äußerungen sogar aktiv dazu beitragen wollen. Während überall um mich die Grenzen geschlossen und mancherorts Grenzzäune errichtet werden. Während eine Innenministerin seelenruhig mit Gewalteinsätzen an den Grenzen kokettiert.
Ich selbst bin es, die jetzt an ihre Grenzen stößt. Ich stehe vor dem Haus meiner Kindheit und lasse meinen wütenden Tränen freien Lauf. Ich habe verstanden, warum dies hier auf mich wirkt wie ein Film. Mit der Realität hat diese Welt nichts mehr zu tun. Ich fühle mich betrogen von der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Es wäre so leicht, den anderen jetzt vorzuwerfen, dass sie schlicht beschränkt sind und die Sache damit abzutun. Aber mit welchem Recht, wenn ich selbst nur so wenig von der Welt wusste, wie sie wirklich ist. Das politische Klima in diesem Land ist über alle Maßen menschenverachtend und ich fühle mich dadurch grundlegend in meiner Identität erschüttert und angegriffen.
Identität ist aber nichts Statisches. Eine Gesellschaft hat nicht einfach Grundwerte, die sie irgendwann historisch erkämpft hat und auf denen man sich fortan immer ausruhen kann. Deshalb weicht meine Wut der Erkenntnis und Entschlossenheit, dass ein jeder neue Tag immer der erste Tag ist, an dem wir gerade erst beginnen, uns gegen Nationalismus, Faschismus und Rassismus zur Wehr zu setzen. Heute ist der erste Tag. Und morgen. Und übermorgen ist wieder der erste Tag. Und am 11. Oktober. Und am darauffolgenden Tag.
Blogkategorie: