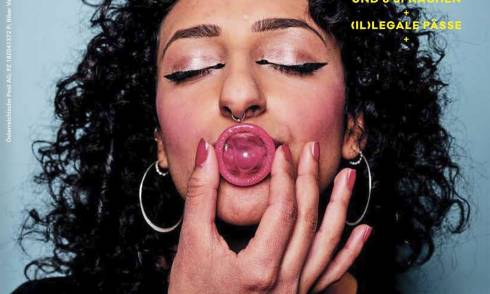Und plötzlich der Konkurs....
Es war alles in Ordnung. Mehr als das sogar. Wir waren in Feierlaune. Nach 11 Monaten beinharter Knochenarbeit hatten wir unser Jahresziel erreicht. „Jetzt nur noch einen ruhigen Jahresabschluss“, dachte ich bei mir, „dass jetzt bloß keine Katastrophe mehr passiert vor Weihnachten“. Als hätte ich eine dunkle Vorahnung gehabt...
An einem Dienstag im Dezember, am frühen Nachmittag kam das erste Mail von der Geschäftsführung. Es dürfen keinerlei Ausgaben mehr getätigt werden, bis zu einem bestimmten Stichtag. Zu diesem Zeitpunkt begann die Gerüchteküche zu brodeln, Wochen der Unsicherheit brachen über uns herein noch bevor wir es überhaupt selbst verstanden haben. Spekulationen, ob dies nun unmittelbar das Ende sei, immer und immer wieder begleitet von dem einen Gedanken, der sich wie Wasser über das brodelnde Feuer der Unklarheit ergoss: So schlimm wird es ja wohl nicht werden.
Schließlich hatten wir gewusst, dass ein schweres Jahr hinter uns lag, das war überall so in dieser Branche. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war noch keine Rede davon, dass es tatsächlich so schlimm war. Wir gingen jeden Tag unserer Arbeit nach, gaben unser Bestes auf allen Ebenen und hatten dadurch das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Es war schlicht unvorstellbar, dass uns all dies nun entgleiten würde. Doch von diesem Zeitpunkt an ging eine Abwärtsspirale los, die mich schon sehr bald eines Besseren belehren sollte.
Ich bin ein privilegiertes Kind, bin sehr gut ausgebildet und es stand mir immer alles zur Verfügung, was ich für einen guten Start ins (Berufs-)Leben brauchte. Noch nie war ich auf staatliche Unterstützung angewiesen. Aber ich werde nie vergessen, wie bedingungslos und schnell wir in unserer Situation von der Arbeiterkammer unterstützt wurden. Die erste Betriebsversammlung fand im Jänner statt, zum ersten Mal war so etwas wie Erleichterung in meinem Team spürbar. Meinem Team, das ich leitete und für das ich mich verantwortlich fühlte. Meinem Team, das stillschweigend weiterarbeitete, obwohl es im Dezember keinen Gehalt bekommen hatte. Die ersten MitarbeiterInnen verabschiedeten sich an diesem Tag von mir. Sie waren ausgetreten, weil ihr Teilbetrieb bereits geschlossen worden war. Es folgte eine Teilbetriebsschließung nach der nächsten, bis schließlich mit Ende März alles vorbei war.
Was diese Wochen mit jedem von uns gemacht haben, lässt sich schwer in Worte fassen. Wie lebloses Geschirr, das einem Tischtuchtrick zum Opfer fiel, hat man uns die Existenzgrundlage unterm Hintern weggezogen und wir blieben verwirrt und orientierungslos zurück und wussten nicht mehr, wo wir stehen. Dabei hatten wir doch alles richtig gemacht. In meinem Umfeld reagierten zwar viele sehr mitfühlend, ein Großteil der Reaktionen beschränkte sich aber auf ein bloßes „Oh“, bevor dann wieder zur Tagesordnung übergegangen wurde. Immerhin hatten sie ja noch einen geordneten Tagesablauf. An manchen Tagen hatte ich schlicht das Gefühl zu ertrinken, in meiner Sorge um die Zukunft, in meiner Überforderung damit, wie es weitergeht, und in all der Unsicherheit, die plötzlich um mich herum ausuferte. Wer hätte von außen die Gefühlswelt in meinem Inneren nachvollziehen können, ich hätte es selbst auch nicht können. Vermutlich ist es somit auch besser, nichts zu sagen, als etwas Unangebrachtes. Und eigentlich war es streng genommen auch nicht notwendig, viel zu sagen, da wir immerhin ein Gesellschaftssystem haben, das ein Sicherheitsnetz bereitstellt. Eine Arbeiterkammer, die uns auf diesem Weg fachlich wie menschlich zur Seite stand, einen Insolvenzfonds, der unsere Gehälter absicherte.
Ein Teil von mir ist deshalb heute dankbar für diese Erfahrung, die mit Sicherheit eine der Lehrreichsten in meinem Leben bisher war. Ich habe gelernt, dass viel zu leisten nicht unbedingt immer zum Erfolg führt. Wir Menschen glauben viel zu sehr daran, mit unserem Tun immer alles beeinflussen zu können. Aber nicht alles, was in der Welt oder in deinem Leben geschieht ist die unmittelbare Reaktion auf dein Handeln. Manches ist einfach unfair. Das Leistungsparadigma in unserer Gesellschaft, mit dem wir seit frühester Kindheit konfrontiert werden, entpuppt sich als glatte Lüge. Macht funktioniert nach gänzlich anderen Prinzipien.
Ich habe in den letzten Wochen tiefe Bewunderung gelernt vor jenen Menschen, die länger auf Arbeitssuche sind und dennoch nie aufgeben. Den eigenen Rhythmus zu verlieren, wenn man nicht einen geregelten Tagesablauf hat und eine Aufgabe, wenn da keine wirkliche Existenzgrundlage ist und man sich Tag für Tag wie auf rohen Eiern bewegt, geht so viel schneller als wir uns vorstellen können. Und dann gibt es da noch Menschen, die arbeiten gehen und vom Lohn ihrer Arbeit nicht leben können. Woher nehmen sie die Kraft, frage ich mich. Was das mit dem eigenen Selbstwert macht, ist für mich nicht auszudenken, aber ein politischer Diskurs, der die arbeitende gegen nicht-arbeitende Bevölkerung mit Slogans wie „Arbeit muss sich lohnen“ ausspielt, um dann den anderen noch mehr wegzunehmen, muss sich für sie anfühlen wie blanker Hohn.
Dinge nicht durch unser eigenes Handeln kontrollieren zu können mag im ersten Moment bedrückend sein, wenn man genau darüber nachdenkt, eröffnet dies aber auch viele Freiheiten. Das Hamsterrad, in dem ich mich bewegt habe, wäre so oder so am selben Punkt angekommen, unabhängig davon, wie schnell ich gelaufen bin. Es hätte keinen Unterschied für das Große und Ganze gemacht, wenn ich den einen oder anderen Urlaubstag mehr genommen hätte, wenn ich meinen Zeitausgleich genommen und mir mehr Zeit für mich genommen hätte, anstatt meine beruflichen Verpflichtungen immer in den Vordergrund zu stellen. Aber für mich und mein Leben hätte es einen großen Unterschied gemacht.
Ich bin in einer Situation, in der ich das Glück habe, Dinge auch von dieser Seite sehen zu können. Ich hatte nach wenigen Wochen bereits ein neues Jobangebot und konnte nahtlos weitermachen. Nicht viele haben so viel Glück. Ich bin ein privilegiertes Mädchen und ich weiß heute: Es kann absolut jeden treffen. Sicherheit ist nicht mehr und nicht weniger als eine Illusion, in der wir es uns gemütlich machen, um von dort aus mit dem Finger auf andere zu zeigen. Existenzangst und Angst vor der Zukunft sind zwei Dinge, die mich immer begleiten und die, wie ich denke, prägend sind für meine Generation. Nach den letzten Wochen, in denen ich beinhart, eiskalt und plötzlich damit direkt konfrontiert wurde, bin ich paradoxerweise gelassener. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es ein Auffangnetz gibt und dass es immer irgendwie weitergeht. Nach dieser Erfahrung gibt es für mich nur eine einzige Sache, die mir wirklich, wirklich Angst vor der Zukunft bereitet: In einer Gesellschaft zu leben, die eine grundlegende Solidarität nicht mehr lebt und wertschätzt, die nicht mehr dafür steht, einander in schweren Zeiten zu (er)tragen, sondern all jene denunziert, denen das Glück im Leben nicht immer so wohlgesonnen war, obwohl sie sich die Hacken wundgelaufen haben in diesem endlosen Rad der Abhängigkeiten.
Blogkategorie: